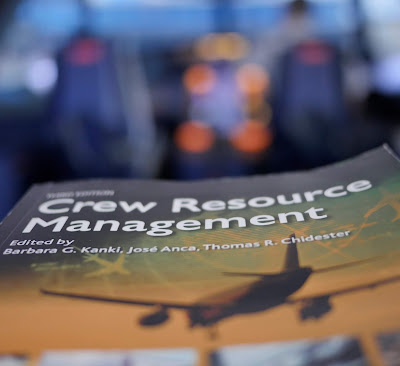Vor wenigen Monaten erschien das neue, dritte
Standardwerk zum
Führungs- und Arbeitsmodell
Crew-Resource-Management (CRM).
Die Forschung zum Crew-Resource-Management steht nie still, da die
schnellen Veränderungen in der Luftfahrt stets neue Verhaltensmuster und Anforderungen erkennen lassen. Vor allem der große Einfluss von
KI in Cockpits führt immer wieder zu neuen oder veränderten Regeln, Verfahren und Verhaltensweisen innerhalb der Cockpit- und Kabinen-Teams.
Als Ende der 1970er-Jahre Professor
Robert (Bob) Helmreich als einer der Urväter das CRM ins Leben rief, betrat er Neuland in der Forschung. Erstmals hat ein Wissenschaftler in dieser Form und Dimension Menschen an ihrem Arbeitsplatz, also in einer
nicht künstlich geschaffenen Umgebung, in ihrem Verhalten untersucht.
Auslöser war die schnell steigende Zahl an Luftfahrtunfällen in den 1960er und 70er-Jahren. Sie stand in keinem akzeptablen Verhältnis zur ebenfalls schnell wachsenden technischen Zuverlässigkeit von Flugzeugen.
Bob Helmreich und sein Team waren die ersten Verhaltensforscher, die in dieser Deutlichkeit und Konsequenz
Teamversagen sichtbar machten. Etwa 80% der fatalen Unglücke in der Luftfahrt basierten auf menschlichem Versagen, explizit auf dem
Versagen des Teamleiters (Kapitän).
Das führte häufig zu
komplettem Teamversagen und, in zunehmendem Maße, zu den erwähnten Unfallzahlen. Es gipfelte 1977 im bisher schwersten Unfall der zivilen Luftfahrt.
Auf dem Flughafen Teneriffa Los Rodeos (heute Teneriffa Nord) verloren beim Zusammenstoß zweier Jumbo-Jets (B747) beim Startvorgang fast 600 Menschen ihr Leben. Wesentlicher „Förderer“ einer vier Stunden vor dem Unglück beginnenden,
fatal endenden
Ereigniskette war einer der renommiertesten Flugkapitäne der Welt. Kapitän Jacob Veldhuyzen van Zanten, 50 Jahre alt, Chefpilot der KLM, startete seine voll besetzte B747 bei dichtem Nebel ohne Startfreigabe.
Die fehlte, weil ein PAN AM Jet, ebenfalls eine B747, quer auf dieser einzigen Startbahn, etwa im hinteren Drittel stand. Die Crew hatte im Nebel Orientierungsschwierigkeiten, da das spanische Bodenradar in Los Rodeos defekt und ihre Sicht extrem schlecht war. Aus Flugzeugcockpits hat man eh schon eine schlechte Sicht, in der 747 ganz besonders.
Weder sein 1. Offizier noch der Bordingenieur hinter ihm im Cockpit konnten van Zanten davon abhalten den Start des KLM-Airliners einzuleiten. Beide äußerten Bedenken, da sie keine Startfreigabe im regen, etwas chaotischen Funkverkehr gehört haben. Normal muss beim geringsten Zweifel beim Tower nachgefragt werden.
Doch bei Jacob van Zanten lagen die
Nerven blank, entsprechend schroff war seit geraumer Zeit sein Ton im Cockpit, zur Kabinencrew und zum Bodenpersonal. Er, als Chefpilot von KLM, wollte auf keinen Fall den Pünktlichkeitsrekord der Airline weiter strapazieren. Van Zanten galt als enorm ehrgeizig und zielorientiert. So waren die beiden weiteren Piloten im Cockpit des Großraumjets so stark eingeschüchtert, dass sie ihrem Chefpiloten lieber
in den Tod folgten als sich ihm zu widersetzen.
Als die Untersuchungsergebnisse aus den Black-Boxes, anderen Aufzeichungen und Befragungen der übrig gebliebenen Beteiligten vorlagen, lief es den Airline-Verantwortlichen kalt den Rücken runter, nicht nur bei KLM. Diese bis dahin unvorstellbare Katastrophe gilt als die (traurige) Geburtststunde des bisher
einzigartig erfolgreichen Führungs- und Arbeitsmodells – dem Crew-Resource-Management der Luftfahrt.
In der neuen, dritten Ausgabe des CRM-Werks wird die
Rolle der Human Factors, wie die Wissenschaft das weite Feld menschlichen Einflusses auf Arbeitsabläufe und deren Ergebnisse nennt, nochmal neu justiert.
Dass Computer geschlossene Systemkreise steuern können, das gibt es in der Luftfahrt schon länger. Nehmen wir den Autopiloten als Beispiel. Konnte er anfangs Kurs und Höhe halten, war er zunehmend in der Lage vorgewählte Strecken abzufliegen, Steig- und Sinkflugprofile selbständig einzuhalten, die Geschwindigkeit beizubehalten und sogar automatische Landungen (Autoland) zu absolvieren. Das war schon Ende der 1970er-Jahre möglich.
Den nächsten großen Schritt vollzog die Luftfahrt mit der Einführung des sogenannten Glascockpits. Analoge Instrumente wurden zunehmend auf Bildschirmen dargestellt und kombiniert. Es entstanden Begriffe wie Primary Flying Display (PFD) etc.
Piloten mussten sich daran gewöhnen, viele Informationen gebündelt an einer Stelle auszuwerten. Bisher waren sie gewohnt, mit Scantechniken (T-Scan) Instrumente abzulesen und zu interpretieren.
Mit dem Wegfall des dritten Mannes an Bord, dem Bordingenieur, gelangte erste, echte KI in die Cockpits der Verkehrsluftfahrt. Computer übernahmen die Triebwerkssteuerung sowie wesentliche Schalt- und Kontrollfunktionen der Flugzeugtechnik. Auch die Steuerung beim ersten zivilen „Fly by Wire“ Flugzeug der Welt, dem Airbus A320, stellte Piloten ab 1988 vor ganz neue Herausforderungen. Der große Steuerknüppel wich vergleichsweisen kleinen Sticks seitlich der Piloten, die die Steuerwünsche des jeweils fliegenden Piloten an Computer weiterleiten. Die Elektronengehirne entscheiden dann, welche Ruder sie wie bewegen. Dabei folgen sie fest programmierten Regeln in definierten Reaktionsräumen, den sogenannten Envelopes. Die kann der Pilot normal nicht überschreiten oder unterwandern.
Diese neue Intelligenz war der Auslöser für viele Unfälle der Airbus A320 ff. Modelle in den 1980er- und 1990er-Jahren.
Das ging bis ins Jahr 2009, als ein Air France A330 über dem Südatlantik durch Crewversagen ins Meer stürzte. Beide Piloten begriffen nicht mehr, was die Computer vorhatten. Eine einzige, richtige Steuerbewegung des fliegenden Piloten hätte ausgereicht um 228 Menschen das Leben zu retten. Aber, beide Piloten erkannten nicht, dass die intelligenten Steuercomputer ihre Reaktionsmuster aufgrund vereister Sensoren änderten bzw. automatische Funktionen abschalteten.
Ein plötzliches
Komplettversagen aller an sich redundanten Steuercomputer im Jahr 2008 bei einem A330 der Quantas (bis dahin galt das als unmöglich) führte nur deshalb nicht zur totalen Katastrophe, weil der Flugkapitän, ein erfahrener Militärpilot, auf Reaktionsmuster von versagenden Steuercomputern bei Kampfflugzeugen trainiert war.
So gab es zwar 100, teils schwer verletzte Passagiere und Kabinencrew-Mitglieder, bedingt durch die wilden und abrupten Sinkflugmanöver eines völlig kollabierenden Steuersystems. Kapitän Kevin Sullivan gelang jedoch die Meisterleistung, das nervenkranke Flugzeug im Not-Steuermodus komplett manuell auf einem nahegelegenen australischen Militärflugplatz ohne Bruch notzulanden.
Nicht so gut verliefen die Ereignisse bei Boeing im Jahr 2018 und 2019. Das aufgrund von Sensorschäden fehlerhaft reagierende MCAS, eine Software im Modell der neuen Boeing 737MAX, die eigentlich Piloten vor einem unkontrollierten Flugzustand bewahren soll, verwirrte die beiden Cockpit-Crews derartig, dass sie, verbunden mit weiteren gravierenden Handlings- und Kommunikationsfehlern die Maschinen in den Boden bzw. die See flogen. Über 300 Menschen starben.
Immer wieder müssen
Verfahren,
Verhaltensmuster und Regeln der sich
rasant weiter entwickelten
Technik angepasst werden. Dazu gehört
stetes und viel
Training, und eine sich laufend verändernde Ausbildung der Crews.
Das CRM ist auf diese
schnellen Reaktionen eingestellt. Dank eines hervorragend entwickelten und extrem schnell greifenden
TEM´s (Thread an Error Management) gelingt es in der Luftfahrt, bei Erkennen von Fehlern, schnell die nötigen Konsequenzen zu ziehen. Warum das beim CRM in der Luftfahrt so gut funktioniert und welche Grund-Voraussetzungen dafür nötig sind, darauf bin ich in meinen Artikeln schon genau eingegangen.
Zwei wesentliche Punkte betonen die Autoren Anca, Kanki und Chidester schon auf ihren ersten Seiten dieses
aussagestarken neuen Werkes:
ein wesentlicher Faktor der Luftfahrtsicherheit ist, neben dem Crew-Resource-Management, die enorme Zuverlässigkeit der Technik in heutigen Flugzeugen. Das ist zwar schon länger so, erreicht aber erst seit kurzem auch die ganze Weltluftfahrt. Selbst in entlegenen Ländern Afrikas oder Asiens fliegen kleine Airlines heute hochmodernes, neues Fluggerät.
Das wirft jedoch gleichzeitig ein
neues Problem auf, das bisher seine negative Wirkung nicht so entfalten konnte.
So sind es nach Stand der Forschung eben nur 50%, die die Technik zur Sicherheit beiträgt, das CRM stellt die anderen 50%. Genau an dieser sorgfältigen Crew-Resource-Management-Ausbildung fehlt es jedoch in Drittländern noch häufig, vor allem bei Low-Budget Airlines, die dort wie Pilze aus dem Boden schießen. Die beiden B737MAX Abstürze in Indonesien und Afrika liegen zu einem großen Teil auch darin begründet, dass den Piloten das umfassende Human-Factor Training des Crew-Resource-Managements nach westlichem Standard fehlte. Sie wurden von ihrer Technik im Cockpit schlicht überrannt!
Ein zweites Thema, das ich schon nach den ersten Seiten extrem aufregend finde, sind die Erkenntnisse zur
Resilienz. Erstmals wird dieser Begriff in der „offiziellen“ CRM-Literatur überhaupt benutzt.
Die Verhaltensforscher sagen dabei gleich vorweg: der bisherige, häufig verwendete Ansatz der individuellen Resilienz-Betrachtung greift im CRM erheblich zu kurz. Selbst die Differenzierung zwischen individueller, gruppen- und organisationsbezogener Resilienz reicht nicht aus um Sicherheit in der Luftfahrt ausreichend zu unterstützen. Es kommt eine völlig neue, andere Ebene ins Spiel: die strategische und taktische Resilienz.
Ich bin deshalb so gespannt bei diesem Thema, weil die CRM-Forschung in der Luftfahrt immer
dicht am tatsächlichen Arbeitsplatz der untersuchten Menschen agiert. Und sie verliert sich nicht in theoretischen, kaum in der praktischen Wirkung belegbaren Modellen.
Eine Stelle, die mir ebenfalls schon auf den ersten Seiten dieses Buches sehr gefällt, ist die neue
Zusammenfassung der Definition von Crew-Resource-Management:
gutes Teamwork.
Und darum geht es heute in den allermeisten Fällen, um Teamwork. Teamwork in
echten und erfolgreichen Teams. Je komplexer die Welt, je fortgeschrittener die Technik ist, desto mehr spielt richtiges,
fehlerarmes und effizientes
Teamwork eine entscheidende, wenn nicht DIE entscheidende Rolle im
Ergebnis der Arbeit.
Umgekehrt ist der Schluss zulässig: fehlt es an erfolgreichem Teamwork, ist das Ergebnis in Zukunft immer schneller fatal.
In diesem Sinne – ich halte Sie auf dem Laufenden bei meiner Lektüre dieser dritten, neuen Standortbestimmung des Crew-Resource-Managements der Luftfahrt.
Ihr
Thomas Fengler